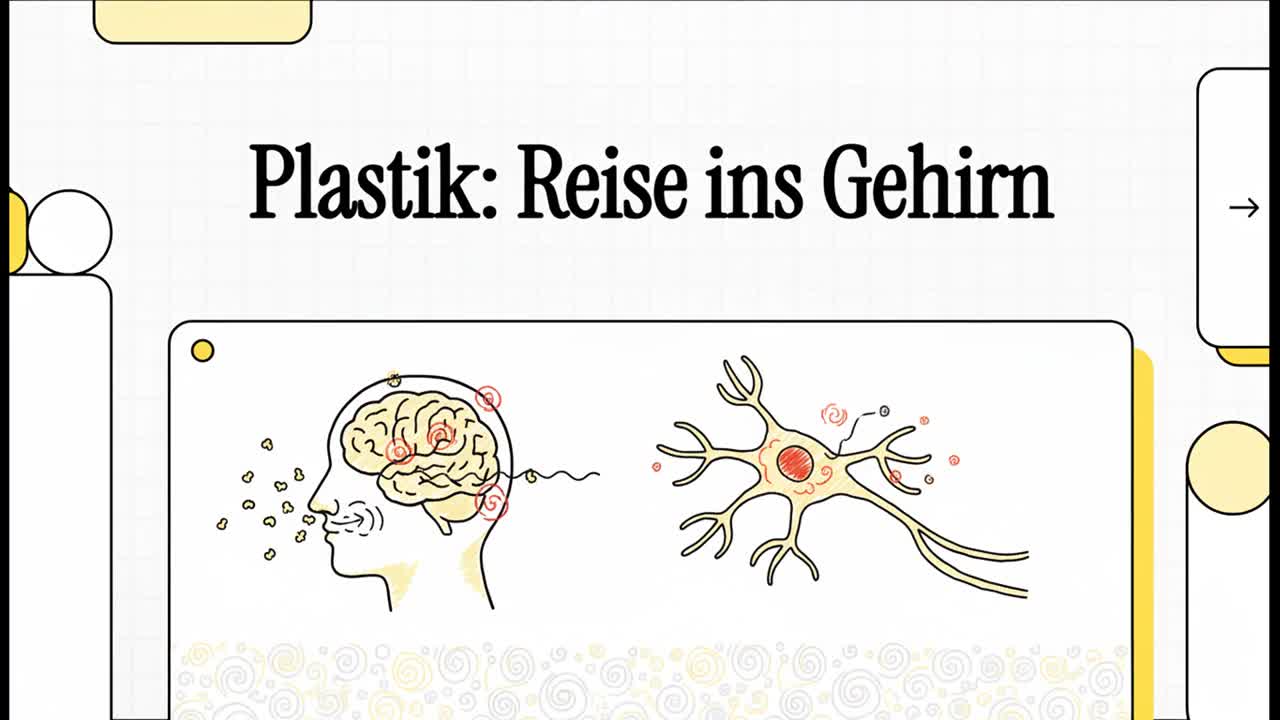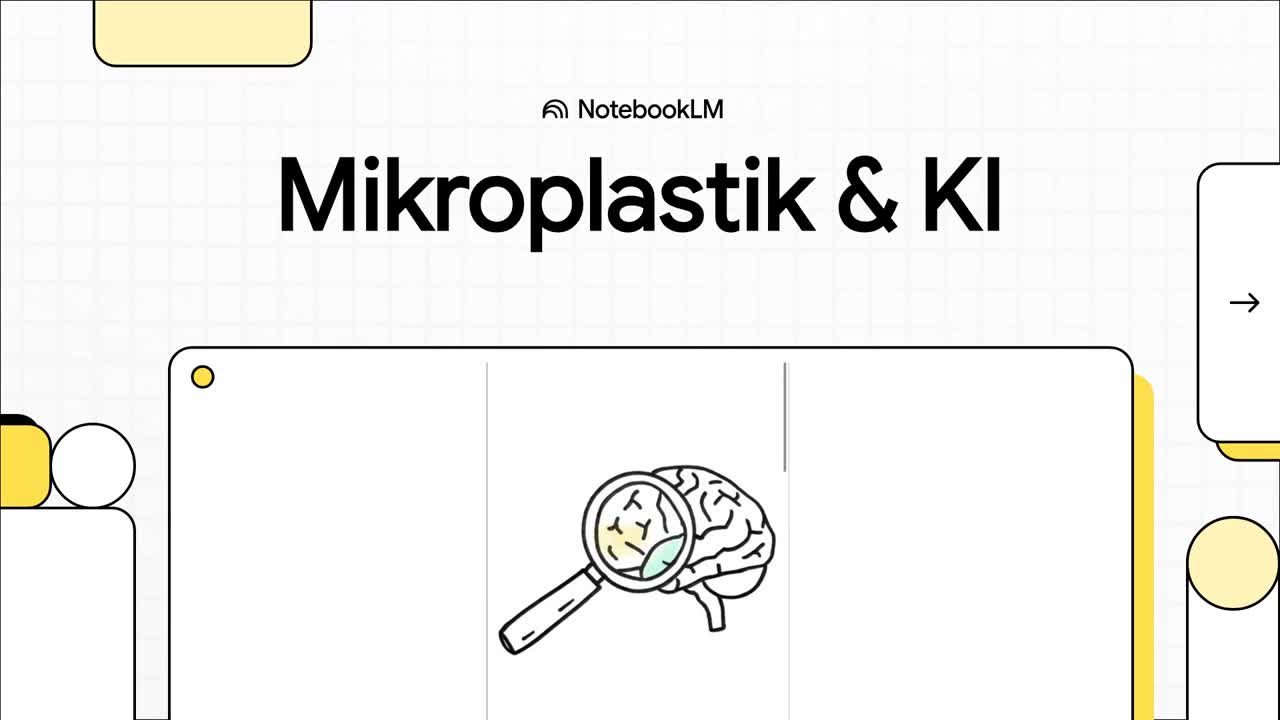White Paper: Gesundheitliche Beurteilung von Mikroplastik in der Aussenluft – Eine wissenschaftliche Bestandsaufnahme
Einleitung: Die unsichtbare Herausforderung in unserer Luft
Seit dem Beginn ihrer Massenproduktion Mitte des 20. Jahrhunderts sind Kunststoffe aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Ihre Langlebigkeit und Vielseitigkeit haben zu einer beispiellosen globalen Verbreitung geführt, doch diese Beständigkeit ist auch ihre grösste Schwäche.
Durch Alterung, Abrieb und Fragmentierung reichert sich Mikroplastik – Kunststoffpartikel kleiner als fünf Millimeter – unaufhaltsam in allen Umweltkompartimenten an: in Böden, Gewässern und zunehmend auch in der Luft.
Während die Kontamination von Wasser und Nahrungsmitteln bereits intensiv untersucht wird, entwickelt sich die Belastung der Luft zu einer kritischen und neuartigen Herausforderung für die öffentliche Gesundheit, die aufgrund der Allgegenwart der Quellen und der nachgewiesenen biologischen Aufnahme durch den Menschen sofortige Aufmerksamkeit erfordert.
Dieses White Paper verfolgt das Ziel, den aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstand zu Mikroplastik in der Aussenluft zu synthetisieren.
Es beleuchtet die gesamte Wirkungskette: von den Quellen und Messmethoden über die Aufnahme und Verteilung im menschlichen Körper bis hin zu den potenziellen Gesundheitsrisiken. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf neu erforschten neurologischen Effekten, die zeigen, dass die Partikel sogar in das menschliche Gehirn vordringen können.
Die Analyse richtet sich an Umwelt- und Gesundheitsorganisationen, um eine fundierte Grundlage für die Bewertung dieser neuen Herausforderung zu schaffen. Für eine zielgerichtete Analyse ist es unerlässlich, die komplexen Eigenschaften dieser Partikel zu verstehen. Daher beginnt die folgende Untersuchung mit einer klaren Definition und Charakterisierung von Mikroplastik, die für dessen Verteilung und toxikologische Wirkung entscheidend sind.
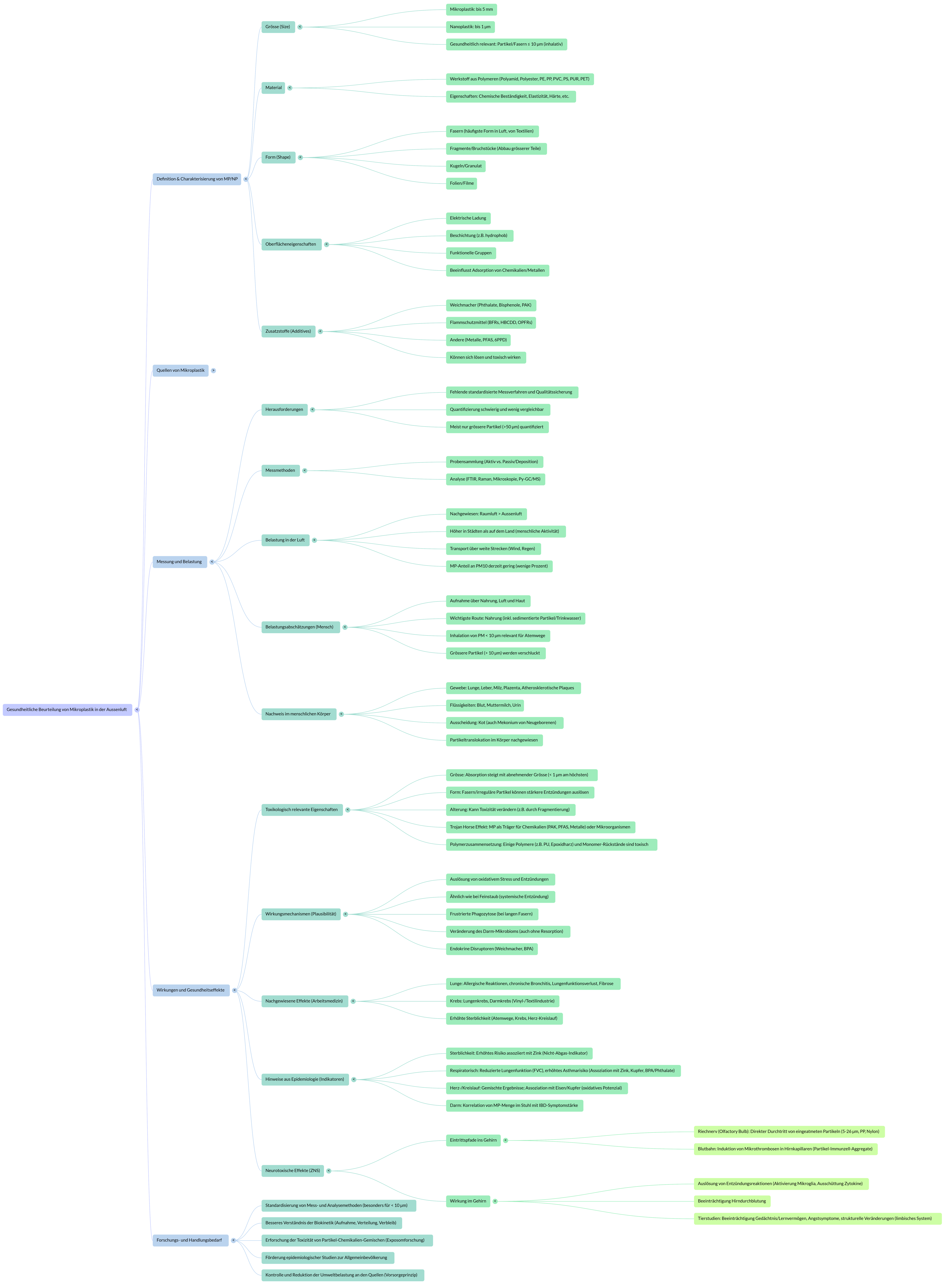
Zum Download der Mindmap hier klicken.
2. Definition und Charakterisierung: Was ist Mikroplastik und warum sind seine Eigenschaften entscheidend?
Um die Verteilung von Mikroplastik in der Umwelt und seine toxikologische Wirkung auf den Menschen zu verstehen, ist eine detaillierte Charakterisierung der Partikel unerlässlich.
Mikroplastik ist kein einheitlicher Schadstoff, sondern ein hochkomplexes Gemisch aus unzähligen Partikeln, die sich in Grösse, Material, Form, Oberflächenbeschaffenheit und chemischer Zusammensetzung fundamental unterscheiden.
Jede dieser Eigenschaften beeinflusst, wie sich ein Partikel in der Atmosphäre verhält, wie es vom Körper aufgenommen wird und welche biologischen Reaktionen es auslöst.
Präsentation: Plastik: Reise ins Gehirn, erstellt mit NotebookLM.
Toxikologisch relevante Eigenschaften von Mikroplastik
Grösse: Die Grösse ist der entscheidende Faktor für die Aufnahme in den menschlichen Körper über die Atemwege. Man unterscheidet:
- Mikroplastik: Partikel mit einer Grösse von unter 5 Millimetern (< 5 mm).
- Nanoplastik: Partikel mit einer Grösse von unter einem Mikrometer (< 1 µm).
Für die Inhalation ist insbesondere die Fraktion der Partikel mit einem aerodynamischen Durchmesser von weniger als 10 Mikrometern (µm) gesundheitlich relevant. Diese Partikel sind klein genug, um in die Lunge vorzudringen (lungengängig). Noch kleinere Partikel (< 3 µm) können sogar bis in die Lungenbläschen (Alveolen) gelangen und von dort potenziell in den Blutkreislauf übertreten.
Material und Form: Das zugrundeliegende Kunststoffpolymer bestimmt die Dichte und chemische Stabilität des Partikels. Zu den häufigsten in der Umwelt nachgewiesenen Polymeren gehören:
- Polyethylen (PE)
- Polyethylenterephthalat (PET)
- Polypropylen (PP)
- Polyvinylchlorid (PVC)
- Polystyrol (PS)
- Polyamid (PA) und Polyester (PES)
Bezeichnenderweise handelt es sich hierbei um dieselben Polymere, die wiederholt in menschlichem Lungengewebe, Blut und Plazenta identifiziert wurden, was ihre hohe Relevanz für die Biopersistenz unterstreicht. Die Form der Partikel gibt oft Hinweise auf ihre Herkunftsquelle und beeinflusst ihre aerodynamischen Eigenschaften sowie die Interaktion mit biologischem Gewebe.
Die häufigsten Formen sind Fasern (z. B. aus Textilabrieb), Fragmente (aus dem Zerfall grösserer Kunststoffteile), Kugeln (z. B. aus Kosmetika) und Folien.
Oberflächeneigenschaften: Die physikalisch-chemischen Eigenschaften der Partikeloberfläche, wie ihre elektrische Ladung und Hydrophobie (Wasserabweisung), sind von grosser Bedeutung. Sie bestimmen, wie leicht andere Schadstoffe (z. B. Schwermetalle, organische Verbindungen) an der Oberfläche anhaften können und wie die Partikel mit Zellmembranen im Körper interagieren.
Zusatzstoffe: Kunststoffe enthalten eine Vielzahl von Additiven, die ihnen spezifische Eigenschaften verleihen. Diese Substanzen sind oft nicht fest im Polymer gebunden und können im Laufe der Zeit freigesetzt werden, was ein erhebliches toxikologisches Risiko darstellt.
- Weichmacher:
- Funktion: Machen spröde Materialien wie PVC weich und biegsam.
- Beispiele & Risiko: Phthalate (z. B. DEHP) und Bisphenole (z. B. BPA) sind bekannte endokrine Disruptoren (hormonell wirksame Substanzen) und können leicht aus dem Material migrieren.
- Flammschutzmittel:
- Funktion: Reduzieren die Entflammbarkeit von Kunststoffen in Elektronik, Möbeln und Baumaterialien.
- Beispiele & Risiko: Bromierte Flammschutzmittel (BFRs) und Organophosphat-Flammschutzmittel (OPFRs) sind persistent, können sich in der Umwelt anreichern und stehen im Verdacht, neurotoxisch zu wirken und den Hormonhaushalt zu stören.
- Andere Additive:
- Beispiele & Risiko: Reifenabrieb enthält eine Vielzahl von Chemikalien, darunter 6PPD, eine Verbindung, die zur Verhinderung der Reifenalterung eingesetzt wird. In oxidierter Form (6PPD-Chinon) ist es hochtoxisch für Wasserorganismen. Gemäss der REACH-Verordnung gefährdet die Substanz auch das Leben von Ungeborenen und kann allergische Reaktionen auslösen. Zudem werden Kunststoffen oft Metalle wie Blei, Chrom und Zink beigemischt, die als krebserregend oder toxisch bekannt sind.
Diese vielfältigen Eigenschaften verdeutlichen, dass die Risikobewertung von Mikroplastik eine differenzierte Betrachtung erfordert. Die Analyse ihrer Herkunft ist der nächste logische Schritt, um die Belastung zu verstehen.
3. Quellen und atmosphärische Verbreitung von Mikroplastik
Die Identifikation und Quantifizierung der Emissionsquellen ist von strategischer Bedeutung, um wirksame Reduktionsmassnahmen zu entwickeln.
Man unterscheidet zwischen primärem Mikroplastik, das absichtlich in Partikelform hergestellt wird (z. B. für Kosmetika), und sekundärem Mikroplastik, das durch den mechanischen Abrieb und den Zerfall grösserer Kunststoffprodukte entsteht. Letzteres stellt die dominierende Quelle in der Umwelt dar.
Hauptquellen in der Aussenluft
- Reifenabrieb: Laut Stoffflussanalysen für die Schweiz ist der Abrieb von Fahrzeugreifen die grösste Einzelquelle von Mikroplastik in der Umwelt. Da Reifenabriebpartikel ein komplexes Konglomerat aus synthetischem Gummi, Füllstoffen (Russ) und einer Vielzahl chemischer Additive (wie 6PPD) und Metalle (wie Zink) sind, stellen sie eine vielschichtige toxikologische Herausforderung dar, die nicht allein durch die Betrachtung des Kunststoffpolymers bewertet werden kann. Eine Schweizer Messstudie quantifizierte den Anteil von Reifenabrieb an der Feinstaubfraktion PM10 auf 2 % im städtischen Hintergrund (0,28 µg/m³) und bis zu 11 % an einem strassennahen Standort (2,24 µg/m³) (Rausch et al., 2022). Durch die zunehmende Elektrifizierung der Fahrzeugflotte und das höhere Gewicht von Elektrofahrzeugen wird die relative Bedeutung dieser Quelle für die verkehrsbedingte Feinstaubbelastung voraussichtlich weiter zunehmen. Dies unterstreicht eine kritische politische Herausforderung: Während die Elektrifizierung das Problem der Abgasemissionen löst, könnte sie unbeabsichtigt das Problem der Nicht-Abgas-Emissionen, die Mikroplastik enthalten, verschärfen.
- Textilabrieb: Der Verschleiss von synthetischen Textilien wie Polyester oder Polyamid ist eine weitere dominante Quelle, insbesondere in städtischen Gebieten. Der hohe Anteil von Fasern, der in vielen Messstudien zur Luftbelastung nachgewiesen wird, belegt die Relevanz von Kleidung, Heimtextilien und anderen textilen Produkten.
- Fragmentierung grösserer Kunststoffe: Der Zerfall grösserer Kunststoffabfälle trägt ebenfalls erheblich zur Belastung bei. Wichtige Quellen sind hier landwirtschaftliche Folien, Bauabfälle sowie achtlos weggeworfener Müll (Littering).
Hauptquellen in der Raumluft
Im Gegensatz zur Aussenluft wird die Belastung in Innenräumen fast ausschliesslich von Textilfasern dominiert. Diese stammen aus Kleidung, Teppichen, Polstermöbeln und anderen Haushaltswaren und werden durch menschliche Aktivität kontinuierlich aufgewirbelt.
Atmosphärischer Transport
Die Luft fungiert nicht als Senke, in der sich Mikroplastik dauerhaft anreichert, sondern als ein „Übergangsmedium“ für den Transport und die Verteilung der Partikel. Die Verweilzeit in der Atmosphäre wird von physikalischen Eigenschaften wie Partikelgrösse, Form und Dichte sowie von meteorologischen Bedingungen wie Wind und Niederschlag bestimmt. Sie kann von wenigen Minuten bis zu mehreren Wochen reichen.
Dies ermöglicht den Transport über weite Strecken, wie Funde in entlegenen Regionen belegen, wo Partikel über Distanzen von mehr als 95 km von ihrer Quelle transportiert wurden. Doch wie werden diese unsichtbaren Partikel in der Luft erfasst und quantifiziert?
4. Messmethoden und Belastungssituation: Eine methodische Herausforderung
Die zentrale Herausforderung bei der wissenschaftlichen Bewertung der Mikroplastikbelastung liegt im Fehlen standardisierter Mess-, Analyse- und Qualitätssicherungsverfahren. Die Methoden zur Probensammlung, Probenaufbereitung und Analyse unterscheiden sich von Studie zu Studie erheblich, was einen direkten Vergleich der Ergebnisse erschwert und die quantitative Bewertung der Gesamtexposition limitiert.
Grundlegende Ansätze der Probensammlung
Zwei grundlegende Verfahren kommen zur Anwendung, die unterschiedliche Aspekte der Luftbelastung erfassen:
| Probensammlung | Beschreibung & Zweck | Aussagekraft & Limitationen |
| Aktive Verfahren | Erfassung von Schwebepartikeln (Aerosol) durch aktives Ansaugen eines definierten Luftvolumens. Die Konzentration wird in Partikel pro Kubikmeter (Partikel/m³) angegeben. | Erfasst die für die Inhalation relevante Fraktion; die Ergebnisse sind gut reproduzierbar und ermöglichen die Messung der tatsächlichen Atemluftbelastung. |
| Passive Verfahren | Erfassung der Deposition (Staubniederschlag) auf einer definierten Fläche über einen bestimmten Zeitraum. Die Rate wird in Partikel pro Quadratmeter pro Tag (Partikel/m²/Tag) angegeben. | Gibt Aufschluss über die Gesamtablagerung von Partikeln aus der Atmosphäre; unterschätzt jedoch systematisch die Konzentration der kleineren, lungengängigen Partikel (< 10 µm), die für die Lungengesundheit von grösster Bedeutung sind, und stellt somit möglicherweise das wahre Inhalationsrisiko falsch dar. |
Erkenntnisse aus globalen Messdaten
Trotz der methodischen Unterschiede lassen sich aus den bisherigen Messdaten übergreifende Muster ableiten:
- Nachweis in der Luft: Mikroplastik ist ubiquitär in der Luft nachweisbar, von dicht besiedelten Metropolen bis hin zu entlegenen Regionen wie der Arktis und den Pyrenäen. Letzteres belegt den atmosphärischen Ferntransport.
- Belastungsgradienten: Die Konzentrationen sind in Innenräumen typischerweise höher als im Freien. In der Aussenluft sind städtische Gebiete stärker belastet als ländliche Regionen.
- Anteil am Feinstaub: Der Massenanteil von Mikroplastik am gesamten Feinstaub (PM10/PM2.5) ist nach aktuellem Kenntnisstand gering und liegt meist im einstelligen Prozentbereich. Mit der Reduktion anderer Schadstoffquellen (z. B. Abgase) könnte seine relative Bedeutung jedoch zunehmen.
- Limitationen: Eine wesentliche Einschränkung vieler Studien ist, dass sie sich methodisch bedingt auf die Quantifizierung grösserer, nicht lungengängiger Partikel konzentrieren. Die tatsächliche Belastung im gesundheitlich besonders relevanten Grössenbereich wird dadurch stark unterschätzt (Vethaak & Legler, 2021).
Nachdem die externe Belastung in der Luft quantifiziert wurde, stellt sich die entscheidende Frage, wie diese Partikel in den menschlichen Körper gelangen und was dort mit ihnen geschieht.
5. Exposition, Aufnahme und Verbleib im menschlichen Körper
Der Nachweis von Mikroplastik in menschlichen Geweben und Körperflüssigkeiten schlägt die entscheidende Brücke zwischen der Umweltkontamination und einem potenziellen Gesundheitsrisiko.
Er belegt, dass die Partikel nicht nur eingeatmet oder verschluckt werden, sondern auch die Barrieren des Körpers überwinden und sich systemisch verteilen können.
Primäre Belastungspfade
Die Hauptrouten für die Aufnahme von Mikroplastik in den menschlichen Körper sind:
- Inhalation: Das Einatmen von Partikeln mit der Aussen- und insbesondere der Raumluft.
- Orale Aufnahme: Die Aufnahme über kontaminierte Nahrung und Trinkwasser. Ein relevanter, oft übersehener Pfad ist zudem das Verschlucken von Partikeln, die in den oberen Atemwegen abgeschieden und durch die mukoziliäre Clearance in den Rachenraum transportiert werden.
Biokinetik: Das Schicksal von Mikroplastik im Körper
Um das Schicksal der Partikel zu verstehen, wird das pharmakokinetische Konzept von ADME – Absorption (Aufnahme), Distribution (Verteilung im Körper), Metabolismus (biochemische Umwandlung) und Exkretion (Ausscheidung) – angewendet. Diese Prozesse hängen stark vom Aufnahmeweg und der Partikelgrösse ab.
- Inhalative Aufnahme: Die Grösse der Partikel bestimmt ihre Eindringtiefe in die Atemwege. Partikel unter 10 µm können bis in die Bronchien gelangen, während Partikel unter 3 µm die tiefsten Lungenbereiche, die Alveolen, erreichen. Dort können die Reinigungsmechanismen der Lunge (mukoziliäre Clearance) überfordert sein. Kleinste Partikel im Nanometerbereich haben das Potenzial, die Lungen-Blut-Schranke zu überwinden (Translokation) und so in den Blutkreislauf zu gelangen.
- Orale Aufnahme: Der überwiegende Teil (> 90 %) der oral aufgenommenen Mikroplastikpartikel wird über den Stuhl wieder ausgeschieden. Jedoch ist eine Resorption von kleineren Partikeln (< 150 µm) durch die Darmwand möglich. Einmal im Blutkreislauf, können diese Partikel zu Organen wie der Leber, der Niere und potenziell auch dem Gehirn transportiert werden.
Evidenz aus dem Human-Biomonitoring
Der Nachweis von Mikroplastik in verschiedensten menschlichen Proben untermauert die systemische Belastung des Körpers. Partikel wurden unter anderem in folgenden Geweben und Körperflüssigkeiten identifiziert:
- Lunge und Atemwegsflüssigkeit
- Blut und Blutgefässe, einschliesslich atherosklerotischer Plaques
- Plazenta, Muttermilch und dem Mekonium (erster Stuhl von Neugeborenen)
- Kot von Erwachsenen und Kindern
- Organen wie der Leber und dem Riechkolben des Gehirns
Dieser letzte Befund im Riechkolben liefert den entscheidenden realen Beweis, der die im nächsten Abschnitt beschriebenen mechanistischen Pfade für den Eintritt von Mikroplastik ins Gehirn validiert. Diese Funde belegen zweifelsfrei eine Aufnahme, systemische Verteilung und eine mögliche Anreicherung von Mikroplastik im menschlichen Körper. Dies wirft die dringende Frage auf, welche konkreten gesundheitlichen Auswirkungen diese interne Belastung haben könnte.
6. Potenzielle gesundheitliche Auswirkungen: Von Zellstress bis zu neurologischen Störungen
Obwohl direkte epidemiologische Studien, die die Mikroplastikbelastung der Aussenluft mit Krankheiten in der Allgemeinbevölkerung in Verbindung bringen, noch fehlen, zeichnen Erkenntnisse aus der Toxikologie, der Arbeitsmedizin und aus Studien zu verwandten Luftschadstoffen ein zunehmend klares Bild plausibler Gesundheitsrisiken.
Die Evidenz deutet auf eine Reihe von Wirkungsmechanismen und potenziellen Gesundheitsfolgen hin.
Toxikologische Wirkungsmechanismen
Experimentelle Studien an Zellkulturen und in Tiermodellen haben mehrere Schlüsselmechanismen identifiziert, über die Mikroplastik Schaden verursachen kann:
- Oxidativer Stress und Entzündung: Immunzellen wie Makrophagen erkennen die Partikel als Fremdkörper und versuchen, sie abzubauen. Dieser Prozess kann zur Freisetzung von reaktiven Sauerstoffspezies und entzündungsfördernden Botenstoffen führen, was chronische Entzündungen und Gewebeschäden zur Folge hat.
- Physikalische Schädigung: Insbesondere scharfkantige Fragmente oder lange, biopersistente Fasern können Gewebe direkt mechanisch reizen oder schädigen, ähnlich wie es von Asbestfasern bekannt ist.
- Chemische Toxizität: Die Partikel fungieren als Träger für ihre chemischen Bestandteile. Die langsame Freisetzung von Additiven wie Weichmachern (z. B. BPA) oder Flammschutzmitteln sowie von nicht vollständig polymerisierten Monomeren kann direkt toxische Effekte im umliegenden Gewebe entfalten.
- „Trojan-Horse“-Effekt: Mikroplastikpartikel können in der Umwelt andere Schadstoffe wie Schwermetalle oder polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAKs) an ihrer Oberfläche anlagern und diese wie ein trojanisches Pferd tief in den Körper transportieren.
- Veränderung des Mikrobioms: Verschluckte Partikel können die Zusammensetzung und Funktion der Darmflora stören, was weitreichende Folgen für das Immunsystem und den Stoffwechsel haben kann.
Erkenntnisse aus der Arbeitsmedizin
Studien an Berufsgruppen mit hoher Exposition gegenüber Kunststoffstäuben (z. B. in der Textil- oder PVC-Industrie) liefern wichtige Hinweise auf mögliche Langzeitfolgen. Bei diesen Arbeitnehmenden wurden erhöhte Raten von Lungenfibrose, chronischer Bronchitis und ein erhöhtes Risiko für Lungen- und Darmkrebs sowie eine insgesamt erhöhte Sterblichkeit beobachtet.
Epidemiologische Indizien aus Nicht-Abgas-Studien
Studien, die sich mit verkehrsbedingten Nicht-Abgasemissionen befassen und dabei Indikatoren wie Zink als Proxy für Reifenabrieb verwenden, zeigen Assoziationen mit einer Reihe von systemischen Erkrankungen. Dazu gehören Herz-Kreislauf-Erkrankungen, respiratorische Effekte und ein erhöhtes Lungenkrebsrisiko.
Die genaue Zuordnung der Effekte zum Mikroplastikanteil ist jedoch unsicher, da Reifenabrieb ein komplexes Gemisch darstellt.
Fokus: Neurologische Auswirkungen
Die Entdeckung von direkten Pfaden ins Gehirn stellt einen Paradigmenwechsel dar: Sie verschiebt die Diskussion von einem theoretischen Risiko zu einer nachgewiesenen Bedrohung und verändert die Landschaft der Risikobewertung fundamental. Die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zeigen, dass Mikroplastik nicht nur systemisch verteilt wird, sondern auch die Barrieren zum Gehirn überwinden kann, was besondere Besorgnis hervorruft.
- Pfade ins Gehirn:Zwei Mechanismen wurden nachgewiesen:
- Über den Riechnerv: Eine Studie von Amato-Lourenço et al. (2024) erbrachte den direkten Nachweis von Polypropylen- und Nylon-Partikeln (Grösse 5–26 µm) im Riechkolben menschlicher Gehirne. Dies deutet darauf hin, dass eingeatmete Partikel entlang des Riechnervs wandern und so die Blut-Hirn-Schranke umgehen können.
- Über die Blutbahn: Eine Untersuchung von Huang et al. (2025) zeigte, dass Mikroplastikpartikel im Blutkreislauf zur Bildung von Mikrothrombosen in den feinen Hirnkapillaren führen können. Dies führt nicht zwangsläufig zu einem direkten Durchtritt durch die Blut-Hirn-Schranke, beeinträchtigt aber die lokale Hirndurchblutung und Sauerstoffversorgung.
- Folgen im Gehirn: Tier- und Zellstudien deuten auf potenziell gravierende Konsequenzen hin. Dazu zählen Entzündungsreaktionen durch die Aktivierung von Mikrogliazellen (den Immunzellen des Gehirns). In Mäusen wurden nach der Exposition mit Polystyrol-Mikroplastik bereits kognitive und verhaltensbezogene Beeinträchtigungen wie Gedächtnis- und Lernstörungen beobachtet (Kaur et al., 2024).
Die Kombination dieser verschiedenen Evidenzstränge zeichnet ein zutiefst besorgniserregendes Bild der potenziellen Gesundheitsrisiken durch Mikroplastik, auch wenn eine endgültige und quantitative Risikobewertung für die Allgemeinbevölkerung noch aussteht.
7. Schlussfolgerungen und Ausblick
Dieses White Paper hat den aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstand zur Belastung der Aussenluft mit Mikroplastik und den damit verbundenen potenziellen Gesundheitsrisiken zusammengefasst. Die Analyse der verfügbaren Evidenz führt zu mehreren zentralen Schlussfolgerungen.Die Hauptschlussfolgerungen lauten:
- Ubiquitäre Belastung: Die Exposition des Menschen gegenüber Mikroplastik über die Luft ist eine globale Realität. Das genaue Ausmass der Belastung, insbesondere mit den gesundheitlich relevanten kleinen Partikeln, ist aufgrund methodischer Mängel in der Messtechnik jedoch noch unklar.
- Systemische Verteilung: Mikroplastik wird nach der Aufnahme im menschlichen Körper nicht vollständig eliminiert. Die Partikel verteilen sich systemisch über den Blutkreislauf und können sich in verschiedenen Organen, einschliesslich der Lunge, der Leber und sogar des Gehirns, anreichern.
- Plausible Gesundheitsrisiken: Es existieren plausible toxikologische Wirkungsmechanismen, die durch erste Hinweise aus arbeitsmedizinischen Studien, epidemiologischen Proxy-Studien und experimentellen Daten gestützt werden. Diese deuten auf eine Vielzahl möglicher Gesundheitsfolgen hin – von chronischen Entzündungen und oxidativem Stress über Störungen des Stoffwechsels bis hin zu neu entdeckten neurologischen Effekten.
- Wissenslücken: Trotz der wachsenden Besorgnis ist eine quantitative Risikobewertung für die Allgemeinbevölkerung derzeit nicht möglich. Es fehlen standardisierte Messmethoden, Langzeitstudien am Menschen und ein tieferes Verständnis der Dosis-Wirkungs-Beziehungen für die komplexen Gemische aus Partikeln und Chemikalien.
Angesichts der Evidenz für eine systemische Verteilung im Körper und plausibler neurologischer Schäden stellt das Versäumnis, in standardisierte Überwachungsmethoden und Quellenreduktion zu investieren, ein erhebliches Risiko für die öffentliche Gesundheit dar.
Die stetig steigende Kunststoffproduktion und die Persistenz von Mikroplastik in der Umwelt erfordern daher dringend, bestehende Wissenslücken zu schliessen und gleichzeitig präventive Handlungsstrategien auf der Grundlage des Vorsorgeprinzips zu entwickeln.
8. Forschungs- und Handlungsbedarf
Aus der aktuellen wissenschaftlichen Bestandsaufnahme leiten sich klare strategische Prioritäten für Gesundheitsbehörden, Umweltregulierungsstellen und Forschungseinrichtungen ab, um die Gesundheitsrisiken durch Mikroplastik in der Luft besser zu verstehen und zu minimieren.
- Standardisierung der Messtechnik: Es bedarf der dringenden Entwicklung und Implementierung international anerkannter, einheitlicher Methoden zur Erfassung, Analyse und Qualitätssicherung von Mikroplastik in der Luft. Ein besonderer Fokus muss dabei auf der gesundheitlich relevanten Fraktion der lungengängigen Partikel (< 10 µm) liegen, die in bisherigen Studien oft unterrepräsentiert ist.
- Förderung der Forschung: Die Forschung muss intensiviert werden, um die offenen Fragen zur Biokinetik (Aufnahme, Verteilung, Abbau), zu den toxikologischen Wirkungsmechanismen und zu den Langzeitfolgen zu klären. Notwendig sind insbesondere Studien, die die kombinierte Wirkung von Partikel-Chemikalien-Gemischen untersuchen, sowie prospektive epidemiologische Langzeitstudien, die die Exposition der Bevölkerung mit klinischen Endpunkten verknüpfen.
- Anwendung des Vorsorgeprinzips: Auch ohne einen endgültigen wissenschaftlichen Beweis für die Kausalität aller potenziellen Gesundheitsschäden sollten bereits jetzt Massnahmen zur Reduktion der Mikroplastik-Emissionen an den Hauptquellen eingeleitet werden. Dies betrifft insbesondere die Minimierung von Reifenabrieb durch verkehrsplanerische und technologische Ansätze sowie die Reduktion von Textilfaser-Freisetzung durch nachhaltigere Produktdesigns und verbesserte Filtertechnologien.
9. Mikroplastik & Künstliche Intelligenz
Präsentation: Mikroplastik & KI, , erstellt mit NotebookLM.
Referenzen
- Amato-Lourenço, L. F., Dantas, K. C., Júnior, G. R., Paes, V. R., Ando, R. A., de Oliveira Freitas, R., da Costa, O. M. M. M., Rabelo, R. S., Soares Bispo, K. C., Carvalho-Oliveira, R., & Mauad, T. (2024). Microplastics in the Olfactory Bulb of the Human Brain. JAMA Network Open, 7(9), e2440018. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2024.40018
- Huang, Y. et al. (2025). Microplastics in the bloodstream can induce cerebral thrombosis by causing cell obstruction and lead to neurobehavioral abnormalities. Science Advances, 11(4): eadr8243. DOI: 10.1126/sciadv.adr8243
- Kaur, R. et al. (2024). Manifestation of polystyrene microplastic accumulation in brain with emphasis on morphometric and histopathological changes in limbic areas of Swiss albino mice. Neurotoxicology, 105, 231–246. DOI: 10.1016/j.neuro.2024.10.008
- Kutlar Joss, M., & Probst-Hensch, N. (2024). Gesundheitliche Beurteilung von Mikroplastik in der Aussenluft – Ein Übersichtsbericht der lufthygienischen Dokumentationsstelle LUDOK. Im Auftrag des Bundesamts für Umwelt.
- Rausch, J., Jaramillo-Vogel, D., Perseguers, S., Schnidrig, N., Grobéty, B., & Yajan, P. (2022). Automated identification and quantification of tire wear particles (TWP) in airborne dust: SEM/EDX single particle analysis coupled to a machine learning classifier. Science of the Total Environment, 803, 149832. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.149832
- Vethaak, A. D., & Legler, J. (2021). Microplastics and human health. Science, 371(6530), 672-674. DOI: 10.1126/science.abe5041 Literatur
Aktualisiert am 26.10.2025
Weiterführende Links:
- Lombard Odier, Unsere toxische Beziehung zu Kunststoff überdenken, 30.08.2023.
- The Washington Post, Die Kunststoffe, die wir einatmen, 13.06.2024
- The Conversation, Scientists reviewed 7,000 studies on microplastics. Their alarming conclusion puts humanity on notice, 19.09.2024.
Titelbild Quelle: Stocknation